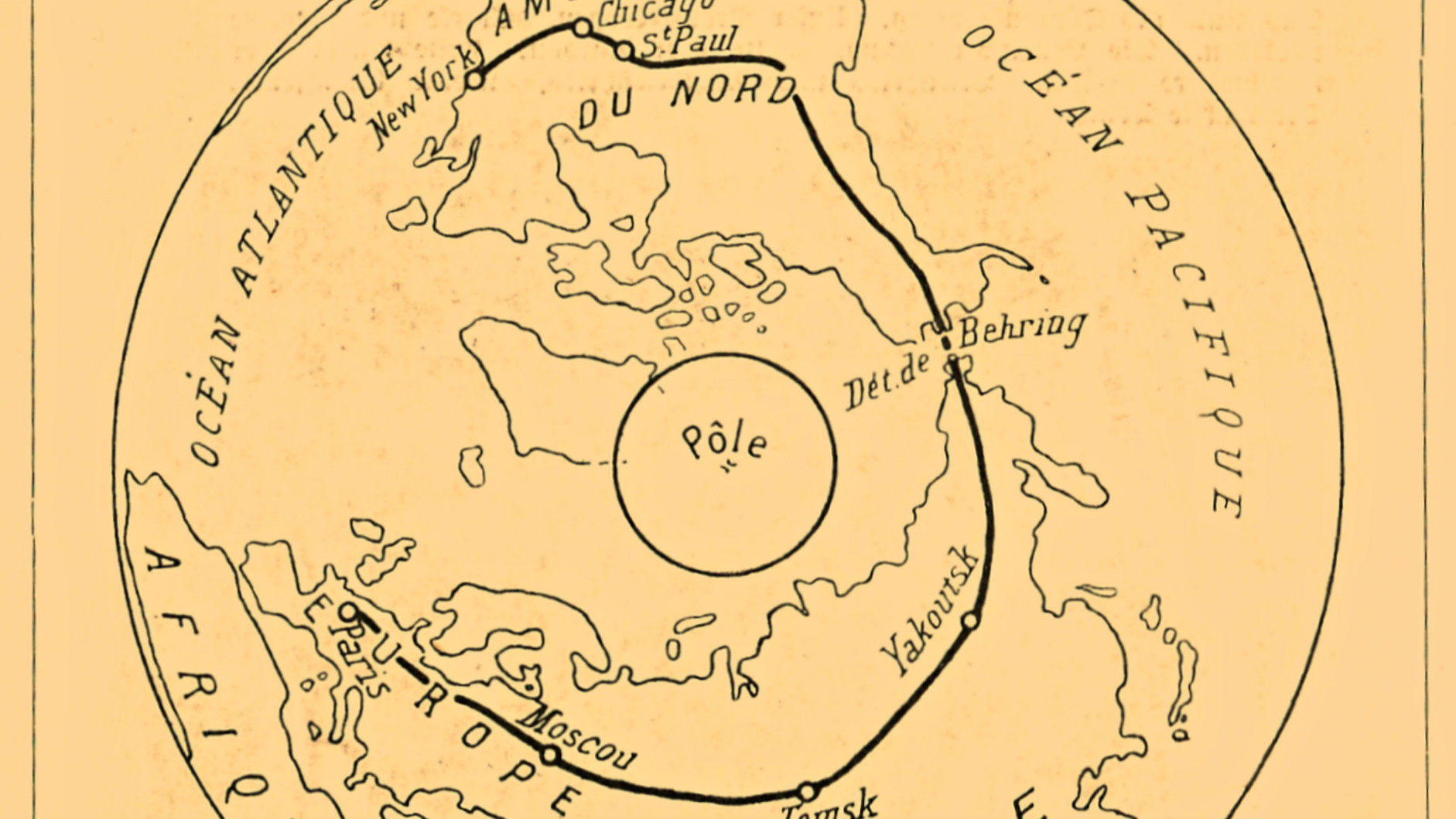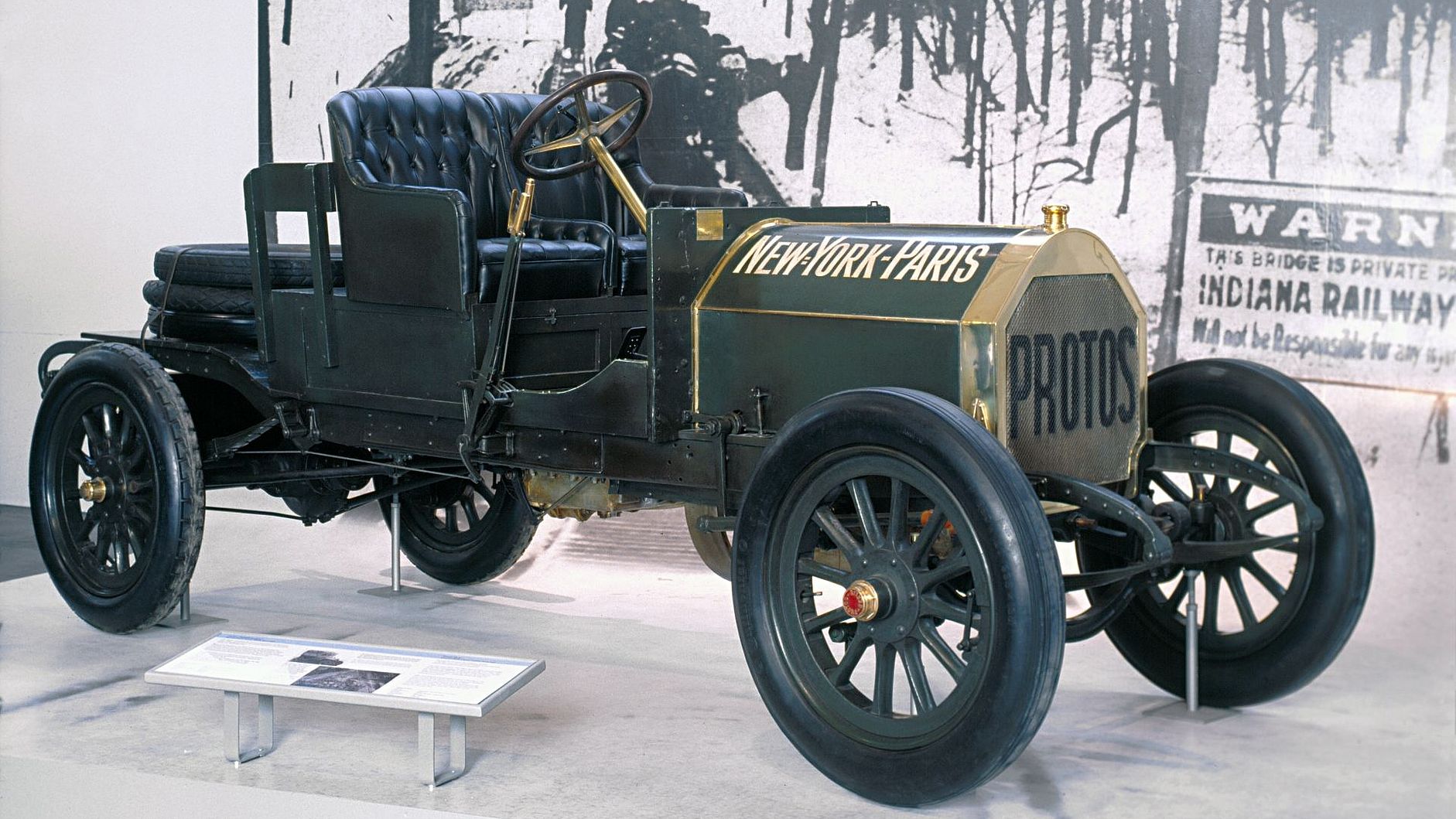Das Musée Automobile de Provence annoncierte wenige Jahre später den Verkauf des Wagens in mehreren Zeitschriften. Darauf aufmerksam geworden, kaufte das Deutsche Museum das Fahrzeug, dass mit seiner besonderen Stromlinie sehr gut ins Konzept einer naturwissenschaftlich-technischen Sammlung passt, im März 1978 an und präsentierte es bis 2003 ununterbrochen in der Kraftfahrzeugausstellung. Der ursprüngliche Auftraggeber, Heinz Rosterg, erfuhr auch selbst von Ankauf und Ausstellung im Deutschen Museum. Laut Sohn Fred Rosterg besichtigten er und sein Vater das Auto Anfang der 1980er Jahre gemeinsam in München.
Bis 2003 war der BMW 328 Wendler in der Abteilung Straßenverkehr ausgestellt. Bei den Vorbereitungen für den Umzug der Abteilung in das Verkehrszentrum ergab eine Bestandsaufnahme, dass die Karosserie durch Verformungen des Holzgerippes stark verzogen war. Mit Rücksicht auf mögliche Transport- und potentielle weitere Strukturschäden durch die Präsentation in der Ausstellung ohne vorhergehende Restaurierung, wurde der Wagen vorerst in ein Depot verbracht und wurde in den Folgejahren Gegenstand verschiedener technischer Untersuchungen und Forschungsprojekte.