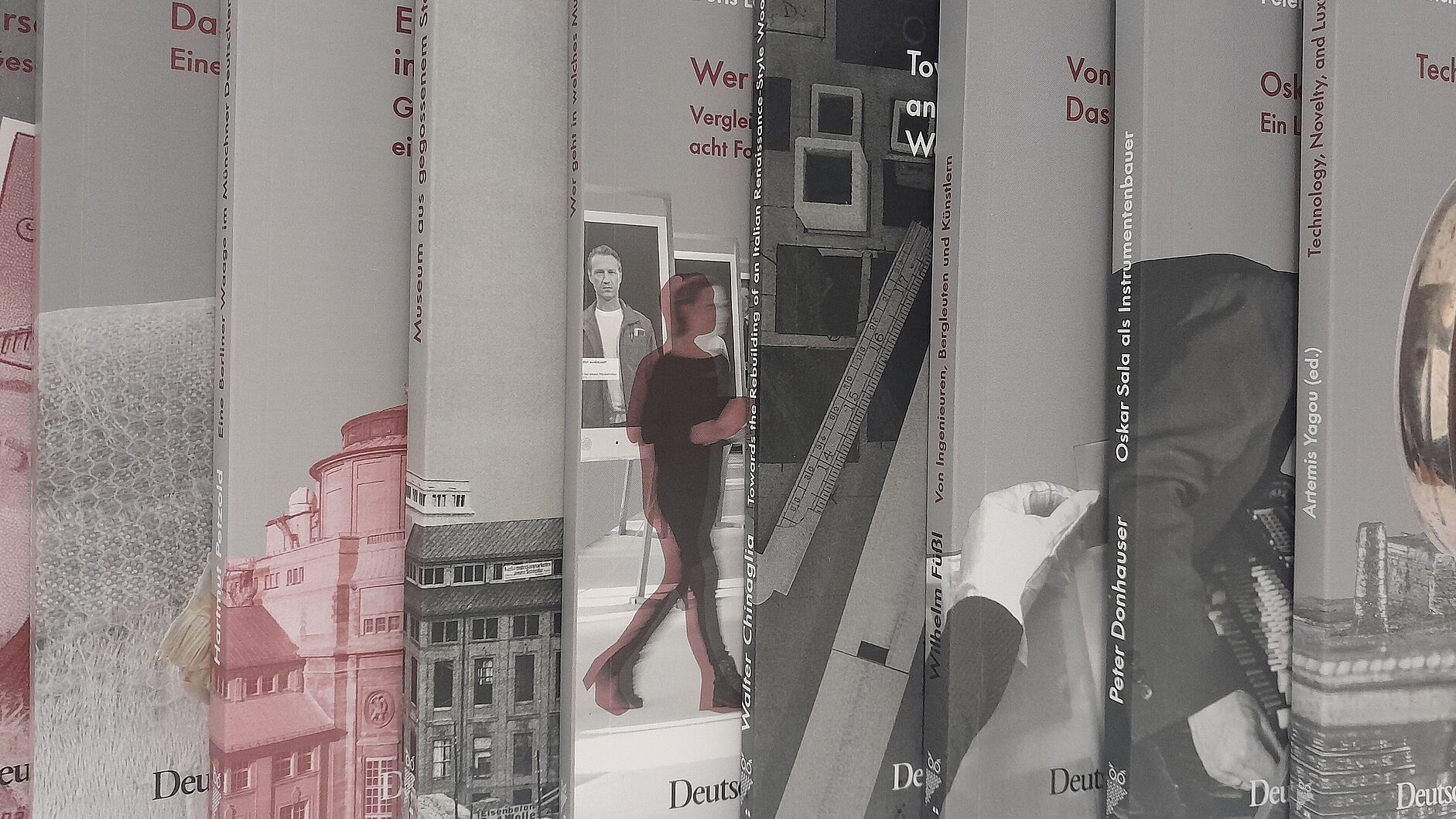Das Ziel war diese Substanz genauso wie das Kairin schnell als Ersatzarzneimittel für Chinin auf den Markt zu bringen. Dafür wollte Ludwig Knorr seinen Syntheseweg patentieren lassen, doch da er zu diesem Zeitpunkt noch als Assistent an der Universität arbeitete, musste er die Erlaubnis von Prof. Emil Fischer einholen. Emil Fischer lehnte dies erst einmal rundweg ab. Ein Kollege riet Knorr daraufhin es noch einmal zu probieren – aber diesmal nachmittags, wenn Emil Fischer gegessen und vom Mittagsschlaf ausgeruht war. Tatsächlich stimmte Emil Fischer der erneuten Anfrage zu, allerdings mit der Bedingung, dass das Patent nicht die weitere Erforschung der grundlegenden Reaktion des Phenylhydrazins mit einem Keton behindern würde.
Am 21. Juli 1883 reichte Ludwig Knorr den Syntheseweg beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin als Patent ein (»Verfahren zur Darstellung von Oxypyrazolen durch Einwirkung von Acetessigestern, ihren Substitutionsproducten und Homologen auf Hydrazine.«). Das Patent wurde am 8. März 1884 erteilt.
Ludwig Knorrs Wunsch nach einer finanziellen Verwertung seiner Entdeckung hatte übrigens ganz praktische Gründe. Wie er seinem Kollegen Hermann Reisenegger in einem Gespräch mitteilte, erhoffte er sich von diesem Patent »eine Beihilfe zum Hausstand«. Deshalb könne er den »materiellen Standpunkt nicht ganz außer Acht lassen«. Denn wenig später heiratete er Elisabeth Piloty, die Schwester von Oskar Piloty, einem Laborkollegen aus seiner Zeit an der Universität München. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Was er damals nicht ahnen konnte: Dieses Patent war nicht nur eine »kleine Beihilfe«, sondern das Antipyrin machte aus Knorr in den folgenden Jahren einen reichen Mann.